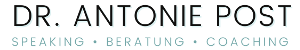Glossar
Was bedeutet überhaupt Health at Every Size® und wie übersetze ich Body Positivity auf Deutsch?
Hier findest du die wichtigsten Anti-Diät- und weitere Begriffe und Definitionen in alphabethischer Reihenfolge.
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, indem Menschen an bestimmten Fähigkeiten – z. B. laufen, sehen, sozial interagieren – gemessen und auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden.
Fähigkeit, den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrzunehmen.
Im Englischen bezeichnet Bias Verzerrungen in unserer Wahrnehmung, beispielsweise durch Stereotype und Vorurteile. Als kleine Kinder sind wir darauf angewiesen zu lernen, was „gut“ und was „schlecht“ ist, was als „normal“ gilt und was von uns erwartet wird. Neben Normen und Werten verinnerlichen wir so auch Stereotype und Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen.
Bezogen auf Studien wird hierunter ein systematischer Fehler verstanden, der zur Verzerrung von Studienergebnissen führt, also zu Ergebnissen, die systematisch in eine bestimmte Richtung von den wahren Werten abweichen.
Essanfall mit dem Gefühl eines Kontrollverlusts, bei dem innerhalb kurzer Zeit große Nahrungsmengen zu sich genommen werden.
Body Positivity in ihrer ursprünglichen Form hat erst einmal gar nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern ist eine aus der Fat Acceptance-Bewegung der 1960er Jahre in den USA entstandene Bewegung, in der sich vor allem schwarze, fette, queere Frauen gegen strukturelle Diskriminierung eingesetzt und um gesellschaftliche Akzeptanz, Teilhabe und Sichtbarkeit dick_fetter Menschen gekämpft haben.
Es gibt kein deutsches Wort, mit dem sich Body Positivity 1:1 übersetzen lässt. Am ehesten trifft es wahrscheinlich der Begriff Körperakzeptanz, was sowohl den Respekt vor dem eigenen Körper als auch allen anderen Körpern mit einschließt.
Ernährungsweise mit dem vorrangigen Ziel, Gewicht zu verlieren oder ein niedriges Gewicht zu halten, indem externen Regeln mehr Wichtigkeit eingeräumt wird als inneren Signalen wie Hunger oder Sättigung.
Der Begriff Diätkultur bezeichnet eine Reihe von Glaubenssätzen, die den Wert eines Menschen
über das bestimmte Aussehen seines Körpers definiert. Besonders Schlanksein wird als Statussymbol verehrt und gleichgesetzt mit Gesundheit, Schönheit, Erfolg und moralischer Überlegenheit.
Diätmentalität ist die Denkweise der Diätkultur und der sogenannte Diet Talk verbreitet ihre Glaubenssätze.
Jede Form der ungerechtfertigten Benachteiligung oder Ungleichbehandlung von einzelnen Personen oder Gruppen aufgrund verschiedener wahrnehmbarer beziehungsweise nicht unmittelbar wahrnehmbarer Merkmale.
Dilemma in der Kommunikation, das eine Situation erschafft, in der zwei oder mehrere sich gegenseitig widersprechende Botschaften miteinander verwoben werden. Die Person, die mit dem Doublebind konfrontiert wird, fühlt sich dadurch automatisch falsch oder im Unrecht, ganz gleich, wie sie reagiert.
Handlungsansatz, der darauf abzielt, dass Menschen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, ihre soziale Lebenswelt und ihr Leben selbst zu erschaffen und sich nicht von außen gestalten zu lassen.
Soziale Bewegung, die versucht, das soziale Stigma eines hohen Körpergewichts aus sozialen Einstellungen zu beseitigen, indem sie die breite Öffentlichkeit auf die sozialen Hindernisse hinweist, mit denen mehrgewichtige Menschen konfrontiert sind.
Extreme Form der Gesundheitsorientierung, die teils ideologische Züge aufweist, in dem Sinne, dass die Beschäftigung mit Gesundheit und gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen langfristig in dominanter Weise das Denken und Verhalten von Menschen prägt und die Beschäftigung mit Gesundheit ein wesentliches Element der emotionalen Stabilität darstellt
Übermäßiger Aufbau von Fettgewebe als natürliche, evolutionär optimierte Reaktion des Körpers auf Hungerperioden, Nahrungsknappheit oder Restriktionsdiäten (»Überschießen« des Fettanteils).
Handlung oder Praxis, eine als mehrgewichtig gelesene Person wegen ihres Körpergewichts zu beschämen, hänseln oder diffamieren.
Zustand eines vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechlichkeit.
Tiefgreifende Überzeugungen und Annahmen zu uns selbst oder zu unserer Umwelt, die als wahr empfunden werden und die großen Einfluss auf unser Leben, unsere Wahrnehmung und Entscheidungen haben.
Health at Every Size® oder kurz HAES® ist eine gewichtsneutrale, medizinisch erprobte Anleitung zu mehr Body Positivity, Gesundheit und Wohlbefinden. Health at Every Size hat seine Ursprünge in den 1970 Jahren in der Fett-Akzeptanz-Bewegung. 2003 hat die Association for Size Diversity and Health (ASDAH) die HAES-Prinzipien konkret in Worte gefasst und sich die Begriffe Health at Every Size und HAES markenrechtlich schützen lassen. Die ASDAH, eine gemeinnützige Organisation, will eine Zukunft erschaffen, in der die Gesellschaft Körper aller Größen und Formen feiert, in der Körpergewicht kein Anlass mehr für Diskriminierung ist und in der sozial benachteiligte und unterdrückte Gemeinschaften einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheit haben.
Verinnerlichen und zu Eigen machen von Auffassungen, Erwartungen, aber auch Werten und Normen anderer, insbesondere der eigenen Familie und sozialen Gruppe.
Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungsformen gegenüber einer Person.
Ernährungsweise, die auf Selbstfürsorge basiert und den Rahmen schafft, die inneren Signale des Körpers wie Hunger, Sättigung und Zufriedenheit zu nutzen, um bedürfnisorientiert zu essen.
Kausalität (von lat. causa = Ursache) ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung oder Aktion und Reaktion.
„Das eine verursacht das andere.“
Gesamtheit der Wahrnehmungen und Vorstellungen vom eigenen Körper und von der Beziehung zu anderen Menschen und sich selbst.
Korrelation (von lat. correlatio = Wechselbeziehung) beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Ereignissen, Zuständen oder Funktionen.
„Das eine steht in Beziehung zum anderen, bedingt es aber nicht zwingend.„
Theorie, die eine neue Sicht auf das Autonome Nervensystem schafft und von dem US-amerikanischen Psychiater und Neurowissenschaftler Stephen W. Porges entwickelt wurde.
Ein Privileg (Plural Privilegien, von lateinisch privilegium „Ausnahmegesetz, Vorrecht“) ist ein Vorrecht, das einer einzelnen Person oder einer Personengruppe aufgrund von Eigenschaften wie Geschlecht, Hautfarbe, Zugehörigkeit etc. zugeteilt wird. Viele Privilegien sind reine Glückssache und liegen außerhalb unserer Kontrolle (z. B. in einen bestimmten Körper oder eine bestimmte Lebenssituation hineingeboren zu sein).
Emotion, die entsteht, wenn man das Gefühl hat, bestimmten Werten, Normen, Regeln oder Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein (»Ich bin schlecht«).
Emotion, die uns wissen lässt, dass wir etwas getan haben, das mit unserem individuellen Wertesystem in Konflikt steht (»Ich habe etwas Schlechtes getan«).
Akzeptierende Haltung der eigenen Person gegenüber, d. h. sich so anzunehmen, wie man ist, mit allem, was man an sich mag und mit allem, was einem nicht an sich gefällt.
Vorstellung über die eigene Person, die eigene Identität und Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen.
Eine wertschätzende Haltung sich selbst gegenüber, sowie das aktive Handeln, mit dem Ziel das eigene körperliche und geistige Wohlergehen sicherzustellen.
Fähigkeit, sich unter dem Gesichtspunkt der eigenen Interessen und Möglichkeiten mit der Umwelt, bezogen auf verschiedene Situationen und Lebenslagen, auseinanderzusetzen.
Allumfassende Annahme der eigenen Person in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst.
Fähigkeit, angesichts der eigenen Fehler oder Unzulänglichkeiten freundlich und verständnisvoll sich selbst gegenüber zu bleiben und sich nicht hart zu verurteilen oder scharf zu kritisieren, weil man etwas nicht kann oder ist.
Bewertung, die man von sich selbst, seinen Eigenschaften und Fähigkeiten hat bzw. der Wert, den eine Person sich selbst zuschreibt und der davon beeinflusst wird, wie sie sich selbst im Moment wahrnimmt und welches Bild sie selbst von sich in der Vergangenheit hat.
Gesamtheit der Gefühle und Emotionen, die jemand angesichts der eigenen Selbstbewertung erlebt.
Psychologisches Phänomen, dass bei der Wahrnehmung nur bestimmte Aspekte der Umwelt aufgenommen und andere ausgeblendet werden. Einfach gesagt: Wir sehen nur das, was wir sehen wollen und/oder was unsere Überzeugungen bestätigt. An sich ist selektive Wahrnehmung nichts schlechtes, denn sie schützt uns vor geistiger Überlastung, hilft uns Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und dementsprechend zu filtern. Gefährlich wird es dann, wenn wir dadurch immer nur unsere bereits vorhandenen Vorstellungen und Urteile bestätigen und auch falsche Schlussfolgerungen nicht mehr überprüfen.
Fähigkeit des Körpers mit bestimmten Erkennungszeichen zu signalisieren, was uns guttut oder schadet und bspw. welche Kost unser körperliches Wohlbefinden fördert oder schwächt.
Als negativ bewertetes Kennzeichen oder Merkmal, das eine Person oder Sache in auffälliger Weise von anderen unterscheidet (»unerwünschte Andersheit«).
Prozess, bei dem verschiedene äußere Merkmale von Personen und Gruppen wie bspw. Religion, Ethnizität, Behinderung, Körpergewicht o.a. mit negativen Bewertungen belegt und durch den Menschen bei gesellschaftlichen Interaktionen hauptsächlich über dieses negative Merkmal wahrgenommen und aufgrund dessen geografisch, wirtschaftlich, sozial oder kulturell an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden (Marginalisierung).
Gewichtsstigmatisierung ist die Zuschreibung von negativen Merkmalen und Eigenschaften allein aufgrund des Körpergewichts und verstärkt Stereotype und die gesellschaftliche Fettfeindlichkeit.
Benachteiligung einzelner Gruppen, die in der Organisation der Gesellschaft begründet liegt. Die oft über Jahrhunderte gewachsene Art des Zusammenlebens (Arbeitsteilung, Machtverhältnisse etc.) geht in der Regel mit patriarchalen, postkolonialen, homophoben, religiösen u.a. Konventionen, Gebräuchen und Traditionen einher, welche die Privilegierung einzelner Gruppen bzw. die Schlechterstellung anderer Gruppen als „normal“ und vorgegeben erscheinen lassen.
Besonderes Recht, ein Vorteil oder eine Immunität, das schlanken oder als schlank gelesenen Menschen gewährt wird oder zur Verfügung steht und dicken Menschen nicht.
Nicht verarbeitete, emotional überwältigende Situationen, die eine Bedrohung für das Leben oder die Unversehrtheit der betroffenen oder einer nahestehenden Person darstellen, wie Unfälle, Schock, Heranwachsen, Erziehung unter erschwerten Bedingungen etc. (»seelische Verletzung«).
Starke Gewichtsschwankungen als Folge von Restriktionsdiäten (»Jo-Jo-Effekt«). Weight Cycling hat ganz unabhängig vom Gewicht einen negativen Einfluss auf die geistige und körperliche Gesundheit und erhöht das Risiko für bestimmte Erkrankungen.