
Wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen würde, wenn mir eine mehrgewichtige Person sagt, dass beim Arztbesuch oder in der Therapie jede noch so fragwürdige Verhaltensweise durchgewunken oder sogar gelobt wurde, solange die Zahl auf der Waage stimmt oder sich die Laborwerte verbessert haben – ich würde in einem weißen Glitzerschloss mit Regenbogenallee und einem Stall voller Einhörner wohnen. Den Hunger austricksen? Großartig! Sich Sport mit Essen verdienen? Sehr löblich! Mahlzeiten auslassen oder ganze Lebensmittelgruppen weglassen? Wie diszipliniert! Ist es nicht ironisch, dass wir Verhaltensweisen, die wir schlanken oder dünnen Menschen in einer Essstörung austreiben wollen, gleichzeitig mehrgewichtigen Menschen „im Namen der Gesundheit“ verschreiben? Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, warum jedes Mittel recht zu sein scheint und jedes Risiko in Kauf genommen wird, nur um aus dicken Menschen schlanke Menschen zu machen. Wenn die Gesundheit nur auf körperlicher Ebene in Zahlen gemessen wird, wie sicher kann ich mir dann sein, dass die mentale Gesundheit nicht hinten runterfällt? Und können wir überhaupt zwischen körperlicher und mentaler Gesundheit unterscheiden?
Die Verbindung von Körper und Geist verstehen
Die World Health Organisation (WHO) definierte Gesundheit 1948 in ihrer Verfassung so: “Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.” Übersetzt heißt das: „Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen.“ Diese Definition wird immer wieder heftig kritisiert, da sie nach Perfektion strebt und dadurch Zustand widerspiegelt, der so für die allermeisten Menschen niemals erreichbar sein wird. Positiv an der Definition der WHO ist, dass neben dem körperlichen auch das geistige und soziale Wohlbefinden miteinbezieht. Leider wird die mentale Gesundheit von vielen Menschen vor allem mit psychischen Störungen assoziiert, die immer noch mit einem Stigma verbunden sind. Aber eigentlich beschreibt die mentale Gesundheit lediglich „einen Zustand des mentalen Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann“ (Definition WHO).
Krankheiten sind nie rein körperlich oder rein psychisch - die Vorstellung gilt als überholt
Häufig betrachten wir Körper und Geist als zwei voneinander getrennte Dinge und behandeln sie dementsprechend. Beispielsweise indem wir unsere Hausärzt:in für körperliche Leiden aufsuchen und unsere Therapeut:in für psychische Herausforderungen. Dabei stehen Körper und Geist untrennbar in Verbindung und die Vorstellung, dass Krankheiten rein körperlich oder rein psychisch sind, gilt mittlerweile als überholt. Forschende finden immer mehr Überschneidungen zwischen den beiden. Beispielsweise können körperliche Erkrankungen wir Krebs oder Infektionen auf direktem Weg die Hirnfunktion beeinflussen und umgekehrt können Störungen der Hirnfunktion bestehende körperliche Erkrankungen verstärken oder sie sogar auslösen. Aber auch Trauer, Stress oder ungelöste Konflikte können sich in Schmerzen, Herzrasen oder Verdauungsstörungen äußern. Oder ein noch konkreteres Beispiel: Wir wissen, dass Menschen, die traumatische Erlebnisse in ihrer Kindheit erfahren, ein um bis zu 60 Prozent höheres Risiko für die Entwicklung eines Diabetes im Erwachsenenalter haben[1,2]. Soweit müssen wir aber gar nicht gehen. Gerade in diesem Moment kommunizieren dein Darm und dein Hirn sehr ausgiebig miteinander, wobei etwa 90 Prozent der Signale, an denen auch maßgeblich die Darmmikrobiota beteiligt sind, vom Darm ausgehen und an den Kopf gesendet werden. Das können wir als Schmetterlinge im Bauch spüren, wenn wir verliebt sind. Aber auch wenn Sorgen und Stress auf den Magen schlagen, wird diese Verbindung deutlich sichtbar.
Es sind die vielen kleinen Nadelstiche, die der Gesundheit schaden
Nun ist es aber so, dass in unserer Gesellschaft niemand „einfach nur dick“ ist. Ein hohes Körpergewicht kommt mit vielen unerfreulichen Begleiterscheinungen wie einer schlechteren Gesundheitsversorgung von mehrgewichtigen Menschen im Vergleich zu schlanken Personen, Diskriminierung im Privatleben und am Arbeitsplatz und Beschämungen im Alltag. Damit meine ich nicht Situationen, in denen einer mehrgewichtigen Person auf offener Straße Schimpfwörter hinterhergerufen werden oder ihr im Supermarkt von wildfremden Menschen Dinge aus dem Einkaufswagen herausgenommen werden mit dem Hinweis, dass sie das lieber nicht essen sollten (und nein, letzteres habe ich mir nicht ausgedacht, schau gerne mal in den Film Your Fat Friend mit Aubrey Gordon[3]).
Es sind die vielen kleinen Nadelstiche, die sich tagtäglich aufsummieren: Keine schönen Kleider in der eigenen Größe zu finden oder sie nur online shoppen zu können, die Diätbroschüre, die einem verstohlen in die Hand gedrückt wird, der Sitz im Kino oder im Restaurant, der nicht auf ein hohes Gewicht ausgelegt ist oder Armlehnen hat, die Ärzt:in, die Angst um ihren Behandlungsstuhl hat, die Filme, die nur schlanke Menschen als Held:innen zeigen und in denen mehrgewichtige Menschen entweder die Bösewichte oder die lustigen Sidekicks sind, die Dickenwitze und die vielen, vielen Bilder von jungen, schlanken, durchtrainierten Menschen in den Medien, die uns tagtäglich umgeben und mehrgewichtigen Menschen immer und immer wieder das Gefühl geben, sie seien nicht gut genug, wie sie sind und würden sie sich nur ein bisschen mehr anstrengen, dann könnten sie auch schlank sein und dann würden sich alle ihre Probleme in Luft auflösen. Das ist geniales Marketing, aber eben nicht die Realität. Mit einer Diät (oder Lifestyle, Ernährungsumstellung, Plan, Programm oder wie auch immer man es nennen will) langfristig Gewicht zu verlieren und zu halten, funktioniert für den Großteil aller Menschen nicht (in Studien ist die Rede von 95-98 Prozent[4]), zwei Drittel wiegen nach der Diät mehr als vorher[5] und allgemein ist es etwa viermal wahrscheinlicher, eine Essstörung zu entwickeln, als mit einer Diät nachhaltig abzunehmen[5,6].
Wie ich mit mir selbst spreche, hat einen größeren Einfluss auf meine Gesundheit als objektive Diskriminierung von außen
Wie so oft bin ich bei einem meiner Lieblingsthemen Korrelation vs. Kausalität und ich kann es nicht oft genug betonen: Ja, ein hohes Körpergewicht ist mit verschiedensten erhöhten Krankheitsrisiken assoziiert. Wir wissen aber nicht, ob das Körpergewicht diese Krankheiten verursacht oder ob es ein Symptom von vielen ist und wir in einer Gesellschaft, in der der schlankere Körper grundsätzlich als „der bessere“ angesehen wird, automatisch diese gedankliche Abkürzung nehmen und dem Körpergewicht die Schuld an den Krankheitsrisiken geben. All das führt in eine Negativspirale aus Schuldzuweisungen, Scham und chronischem Stress – und es wird mir jetzt sicher niemand widersprechen, wenn ich sage, dass Stress ein riesengroßes Gesundheitsrisiko darstellt. Spannenderweise zeigen Studien, dass es wohl einen sehr viel größeren Einfluss hat, wie sehr jemand die Fettfeindlichkeit der Gesellschaft internalisiert hat als eine objektive Diskriminierung von außen[7-10]. Das macht auch Sinn, denn wie ich über mich selbst und meinen Körper denke, hat direkte Auswirkungen, wie ich mich verhalte. Ein Beispiel: Überlege dir mal, wie du dich Menschen gegenüber verhältst, die du liebst. Du wirst das Beste für sie wollen und dich so gut du irgendwie kannst, sich um sie kümmern, sie unterstützen, sie beschützen etc. Nicht, weil du musst, sondern weil die Motivation tief aus deinem Inneren kommt und du es willst bzw. vielleicht gar nicht anders kannst. Genau dasselbe funktioniert auch für dich und deinen Körper. Deshalb bekommst du nun fünf Impulse von mir, wie du ganz nach den Prinzipien von Health at Every Size® sowohl dein geistiges als auch dein körperliches Wohlbefinden positiv beeinflussen kannst.
5 Impulse, um die Gesundheit und das Wohlbefinden positiv zu beeinflussen
1. Befreie dich von der Diätkultur und hinterfrage, was du glaubst, zu Gewicht und Gesundheit zu wissen
Diätkultur heißt nicht einfach nur „auf Diät sein“, sondern der Begriff beschreibt eine Reihe von Glaubenssätzen, die den Wert eines Menschen in erster Linie über das bestimmte Aussehen seines Körpers definiert. Besonders das Schlanksein wird in der Diätkultur als Statussymbol verehrt und gleichgesetzt mit Gesundheit, Schönheit, Fitness, Erfolg und moralischer Überlegenheit. Das Ideal eines schlanken Körpers wird dabei über das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit gestellt.
Für mich ist die Diätkultur schlicht und ergreifend die Wurzel allen Übels rund um das eigene Körperbild und das eigene Essverhalten. Sie ist eine Form des gesellschaftlichen Drucks, der vermittelt, dass ein hohes Körpergewicht ein Makel ist, der „repariert“ werden muss und der Grund, warum sich die wenigsten Menschen wirklich in ihrem Körper wohlfühlen. Solange wir glauben, dass der schlankere Körper nicht nur glücklicher, sondern auch gesünder macht, geben wir unserem Körpergewicht eine Aufgabe, die es gar nicht erfüllen kann.
2. Beschäftige dich mit Intuitiver Ernährung
Wer glaubt, dass intuitiv Essen bedeutet, morgens Schokocrossaint, mittags Pizza und abends Burger zu essen, liegt völlig daneben. Sich die bedingungslose Erlaubnis zum Essen zu geben, ist nur eins von 10 Prinzipien. Intuitiv Essen ist auch viel mehr als essen, wenn man hungrig ist und aufhören, wenn man satt ist oder Achtsamkeit dazu zu missbrauchen, möglichst wenig zu essen. Kurz gesagt schafft das Intuitive Essen die Rahmenbedingungen für ein Essverhalten, das aus Selbstfürsorge motiviert ist. Sei neugierig, schau, was da wirklich hinter den 10 Prinzipien steckt, hab Vertrauen in dich und probiere es aus.
Zu den Ressourcen: >>KLICK
3. Arbeite an einem positiven Körperbild
Das Körperbild beschreibt die individuelle Wahrnehmung des eigenen Körpers und die damit verbundenen positiven oder negativen Gefühle und spielt eine wesentliche Rolle für die geistige und körperliche Gesundheit. Menschen mit einem positiven Körperbild verfügen auch über ein positiveres Selbstwertgefühl, sind im Hinblick auf ihre eigene Persönlichkeit und ihre Handlungen selbstbewusster, leistungsfähiger, glücklicher und schließen leichter Freundschaften. Sie haben ein geringeres Risiko, an einer Depression oder Essstörung zu erkranken, ihr allgemeines Wohlbefinden ist viel besser und sie sind weniger empfänglich für die „Anforderungen“ unserer Gesellschaft, die zum Beispiel von Mädchen und Frauen verlangt, übermäßig schlank zu sein und von Jungen und Männern erwartet, stark und muskulös sein. Ein positives Körperbild macht nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher.
4. Priorisiere regelmäßige Pausen, ein gutes Stressmanagement und erholsamen Schlaf
Regelmäßige Pausen sind wichtig, um konzentriert und produktiv arbeiten zu können. Wer keine Pause macht, begünstigt Fehler, arbeitet langsam und ist einem hohen Stresspegel ausgesetzt. Expert:innen empfehlen mehrere kurze, aber intensive Pausen täglich. Nach etwa 60 bis 90 Minuten Arbeitszeit sollte eine fünfminütige Pause eingelegt werden, um konzentriert weiterarbeiten zu können.
Schlaf ist natürlich wichtig für die Gesundheit und auch für die Leistung. Muskelspannung, Atmung, Herzschlag, Blutdruck, Körpertemperatur, Hormone, Stoffwechsel und andere Funktionen geraten durcheinander, wenn man zu wenig schläft oder der natürliche Rhythmus von Schlafen und Wachen längerfristig gestört wird. Die durchschnittliche Schlafdauer bei Erwachsenen liegt zwischen sieben und neun Stunden pro Nacht – diese kann jedoch stark nach unten oder nach oben variieren. Grundsätzlich lässt sich keine Faustregel für den „richtigen“ Schlaf finden. Jeder Mensch hat bezüglich Schlaf und Schlafrhythmus eigene Bedürfnisse.
Wir können also Stressoren nicht immer vermeiden, aber wir können an unserer Resilienz arbeiten. Das ist unsere psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Auch hier ist es wieder ganz schwierig, konkrete Tipps zu geben, mit denen jeder etwas anfangen kann. Und es gibt ja auch viele Stressoren, die für alle unterschiedlich sind und wir gar nicht beeinflussen können oder zumindest nicht unmittelbar. Das Geheimnis steckt darin, nachhaltig mit den eigenen psychischen Ressourcen umzugehen. Mehr Pausen, auch mal nein sagen zu einer zusätzlichen Aufgabe, weniger Perfektionismus anstreben zu wollen und sich Zeit zu nehmen, um die schönen Momente im Leben zu genießen.
5. Erfreue dich an Bewegung und deinem Körper
Bewegung verbessert nicht nur dein Körperbild, sondern hat natürlich auch ganz viele positive Effekte auf die Gesundheit: Sie verbessert die Leistung deines Herzens, deiner Lunge und deine Muskelkraft verbessern. Wenn du schon älter bist, dann erhält Bewegung die Muskelkraft, schult die Koordination und beugt so Stürzen vor. Regelmäßige Bewegung verringert zudem das Depressionsrisiko und steigert das psychische Wohlbefinden. Die Frage ist nun: Welche Sportart ist die beste? Ganz einfach: Eine, bei der du den inneren Schweinehund überhaupt nicht überwinden musst, weil er nicht vorhanden ist. Du darfst also aufhören, deine Sportart danach auszusuchen, ob sie möglichst viele Kalorien verbrennt und stattdessen eine Bewegungsform wählen, der dir Spaß macht und der dir guttut.
Podcast passend zum Thema
Wie man Geist und Körper trainiert, war auch das Thema der aktuellen Podcast-Episode, in der Inken und Arlow von @workittraininghamburg zu Gast waren. Den Podcast kannst du dir nicht nur auf allen gängigen Streaming Plattformen anhören, sondern seit dieser Staffel auch auf meinem YouTube-Kanal @drantoniepost ansehen.
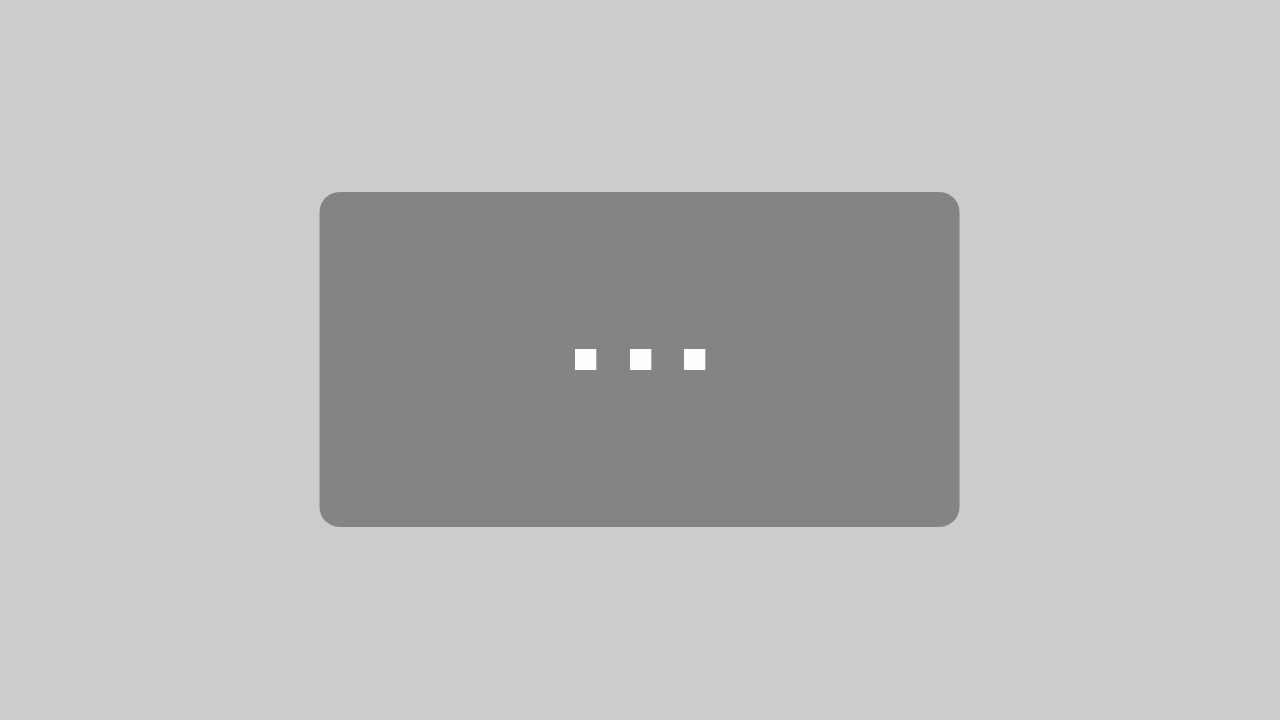
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
[1] Huffhines L, Noser A, Patton SR. The Link Between Adverse Childhood Experiences and Diabetes. Curr Diab Rep. 2016 Jun;16(6):54. doi: 10.1007/s11892-016-0740-8. PMID: 27112958; PMCID: PMC5292871. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27112958/
[2] Huang H, Yan P, Shan Z, Chen S, Li M, Luo C, Gao H, Hao L, Liu L. Adverse childhood experiences and risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Metabolism. 2015 Nov;64(11):1408-18. doi: 10.1016/j.metabol.2015.08.019. Epub 2015 Sep 2. PMID: 26404480. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26404480/
[3] https://www.yrfatfriendfilm.com/
[4] Mann T, Tomiyama AJ, Westling E, Lew AM, Samuels B, Chatman J. Medicare’s search for effective obesity treatments: diets are not the answer. Am Psychol. 2007 Apr;62(3):220-33. doi: 10.1037/0003-066X.62.3.220. PMID: 17469900. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17469900/
[5] Wing RR, Phelan S. Long-term weight loss maintenance. Am J Clin Nutr. 2005 Jul;82(1 Suppl):222S-225S. doi: 10.1093/ajcn/82.1.222S. PMID: 16002825. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16002825/
[6] Dulloo AG, Jacquet J, Montani JP. How dieting makes some fatter: from a perspective of human body composition autoregulation. Proc Nutr Soc. 2012 Aug;71(3):379-89. doi: 10.1017/S0029665112000225. Epub 2012 Apr 5. PMID: 22475574. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22475574/
[7] Puhl RM, Lessard LM, Himmelstein MS, Foster GD. The roles of experienced and internalized weight stigma in healthcare experiences: Perspectives of adults engaged in weight management across six countries. PLoS One. 2021 Jun 1;16(6):e0251566. doi: 10.1371/journal.pone.0251566. PMID: 34061867; PMCID: PMC8168902. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251566
[8] Bidstrup H, Brennan L, Kaufmann L, de la Piedad Garcia X. Internalised weight stigma as a mediator of the relationship between experienced/perceived weight stigma and biopsychosocial outcomes: a systematic review. Int J Obes (Lond). 2022 Jan;46(1):1-9. doi: 10.1038/s41366-021-00982-4. Epub 2021 Oct 9. PMID: 34628466; PMCID: PMC8501332. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34628466/
[9] Puhl R, Suh Y. Health Consequences of Weight Stigma: Implications for Obesity Prevention and Treatment. Curr Obes Rep. 2015 Jun;4(2):182-90. doi: 10.1007/s13679-015-0153-z. PMID: 26627213. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26627213/
[10] O’Brien KS, Latner JD, Puhl RM, Vartanian LR, Giles C, Griva K, Carter A. The relationship between weight stigma and eating behavior is explained by weight bias internalization and psychological distress. Appetite. 2016 Jul 1;102:70-6. doi: 10.1016/j.appet.2016.02.032. Epub 2016 Feb 18. PMID: 26898319. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26898319/
Foto von Total Shape auf Unsplash

